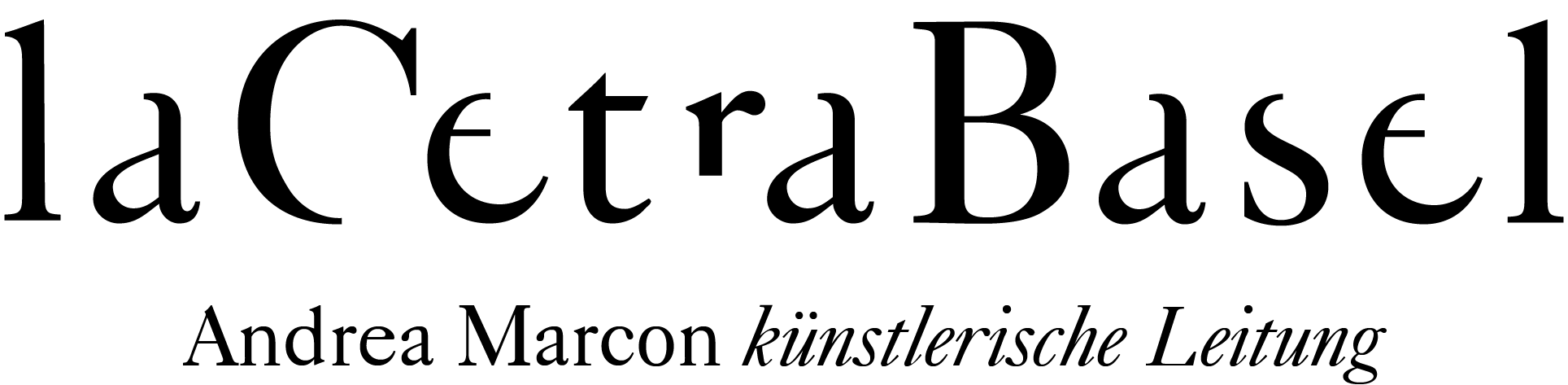Im Jahr 1620 hielt sich der junge niederländische Dichter, Diplomat und Komponist Constantijn Huygens in Venedig auf und berichtete in seinem Tagebuch tief beeindruckt über seinen Besuch eines festlichen Vespergottesdienstes: «Am 24. Juni, dem Fest des Heiligen Johannes des Täufers, führte man mich zur Vesper in die Kirche SS. Giovanni e Lucia, wo ich eine Musik erlebte, wie ich sie kunstvoller in meinem Leben nicht mehr hören werde. Ihr Komponist, der sehr berühmte Claudio di Monteverde, maestro di capella von St. Markus, führte sie bei dieser Gelegenheit auf und dirigierte sie selbst, begleitet von vier Theorben, zwei Zinken, zwei Fagotten, zwei Violinen, einer Bassviola von ungeheuren Ausmassen, Orgel und anderen Instrumenten – alle gleichermassen gut beherrscht und gespielt – ganz zu schweigen von 10 oder 12 Singstimmen. Ich war hingerissen vor Vergnügen.» Abgesehen von der Tatsache, dass Huygens sich offenbar in Bezug auf den Kirchenraum irrte – eine Kirche SS. Giovanni e Lucia gibt es in Venedig nicht –, ist sein Bericht ein wertvolles Zeugnis für die Pracht, mit der die Vespergottesdienste zu seiner Zeit in Italien, besonders in Venedig, gefeiert wurden. Hier erlebte die Vesper ihre Blüte vor allem in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts.
Als Abendgebet am Vorabend des Sonn- bzw. Feiertages ist die Vesper fester Bestandteil der sogenannten Stundengebete. Sie eröffnet die liturgischen Feierlichkeiten des folgenden Tages und folgt einem strengen liturgischen Ablauf: nach der immer gleichbleibenden Eröffnung (Deus in adiutorium und Domine ad adiuvandum me festina) erklingen, dem jeweiligen Tag zugeordnet, vier oder fünf durch Antiphonen umrahmte Psalmen, Lesung, Responsorium, ein Hymnus und als Höhepunkt das Magnificat, der Lobgesang der Maria. Mit der festgelegten Formel Benedicamus Domino / Deo gratias endet das Abendgebet. Dieser auf den ersten Blick starr anmutende Verlauf wirkte jedoch alles andere als einschränkend auf die Komponisten-generation an der Schwelle zwischen Renaissance und Barock. Die Vielfalt der zu vertonenden Texte inspirierte sie ebenso zu immer neuen Kompositionen wie der Reiz, eine neue, den Text in besonderer Weise beleuchtende Vertonung des Magnificat zu komponieren. Auch die Tatsache, dass im Gegensatz zu Vertonungen des Messordinariums, die hinsichtlich ihrer Dauer beschränkt waren, die Vesper kaum Reglementierungen unterlag, bewirkte, dass die Komponisten ihr Hauptaugenmerk auf Vertonungen der Psalmen und des Magnificat legten. So entstanden in Norditalien und speziell in Venedig in den ersten beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts zahllose Vespersammlungen und -drucke, die die Blütezeit dokumentieren. Selten verstehen sich diese Sammlungen als Wiedergabe einer speziellen Vesper für einen festgelegten Tag, enthalten sie doch meistens mehrere Vertonungen eines Textes in unterschiedlicher Besetzung. Sie sind vielmehr als Repertoire- und Auswahlsammlungen zu verstehen, auf deren Inhalt bei der Gestaltung des Abendgebetes zurückgegriffen werden konnte.

Aus unterschiedlichen Sammlungen zusammengestellt erklingt am heutigen Abend eine Vesper, wie sie im Markusdom in Venedig im Laufe der langen Wirkungszeit Claudio Monteverdis als maestro di capella (er bekleidete dieses Amt ab 1613 bis zu seinem Tod 1643) an einem Weihnachtstag erklungen sein könnte. Das Responsorium zur Eröffnung Domine ad adiuvandum me festina entstammt Monteverdis berühmt gewordener Marienvesper, die er 1610, schon vor seinem Amtsantritt am Markusdom, im Druck veröffentlichte. Bei der Komposition dieses Werkes griff Monteverdi auf die Toccata seiner wenige Jahre zuvor entstandenen Oper L’Orfeo zurück. Majestätische Fanfaren und homophone Chorrufe eröffnen den Abend.Das Magnificat und die fünf Psalmen (Dixit Dominus, Confitebor tibi Domine, Beatus vir, Laudate pueri und Laudate Dominum) entstammen alle Monteverdis 1641 gedruckten Sammlung Selva morale e spirituale. In dieser neben der Marienvesper wichtigsten Sammlung geistlicher Werke vereinte Monteverdi eine Auswahl von italienischen und lateinischen Kompositionen, die er während seiner Amtszeit am Markusdom komponiert hatte. Die Vielfalt der Texte und die unterschiedlichen Besetzungen mit Soli, Chor (bis zu achtstimmig) und Instrumenten dokumentieren Monteverdis Vielseitigkeit genauso wie die Verwendung unterschiedlichster Kompositionsstile. Das achtstimmige Magnificat stellt den Höhepunkt der Vesper dar. Ähnlich prachtvoll wie das erklungene Invitatorium vereint es Chor, Soli und Instrumentalstimmen. Taktwechsel zwischen geraden und ungeraden Mensuren durchziehen das Werk, homophone Chorabschnitte (auch doppelchörig im Wechsel) werden von imitatorischen und kurzen solistischen Passagen unterbrochen. Typisch für Monteverdis Kompositionsweise steht immer die Textausdeutung im Mittelpunkt – sei es im zweistimmigen von Koloraturen durchzogenen dispersit superbos als Symbol des «Zerstreuens» oder im majestätischen Ruf Fecit potentiam in brachio suo («er übet Gewalt mit seinem Arm»).

Eingeleitet wurden die Psalmen durch gregorianische Antiphonen und Orgelintonationen von Giovanni Gabrieli, der als Organist bis 1612 am Markusdom gewirkt hatte. Anstelle der nach dem Psalm üblicherweise wiederholten Antiphone erklingen Motetten und Instrumentalwerke von Monteverdi, Gabrieli und ihren Zeitgenossen Alessandro Grandi und Gabriele Usper (zunächst als Schüler seines bekannteren Onkels Francesco Usper als Organist und Komponist in Venedig tätig, später vermutlich in seiner Heimat Istrien). Die Antiphonen durch Figuralmusik zu ersetzen scheint durchaus der zeitgenössischen Praxis zu entsprechen, wie uns der Inhalt der Marienvesper Monteverdis aber auch Sammlungen seiner Zeitgenossen belegen, in denen neben Psalmen und Magnificat-Vertonungen auch Motetten und Concerti enthalten sind.
Auch wenn uns keine eigentliche Weihnachtsvesper aus der Feder Monteverdis erhalten geblieben ist, so könnte sie doch in dieser Form in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Venedig unter seiner Leitung erklungen sein und vermittelt uns ein lebendiges Bild der italienischen Kirchenmusik am Vorabend des Barock.
– Frauke Heinze